Menschen ohne Menschenrechte sind den Unrechten der unrechten Menschen ausgeliefert. Unsere gemeinsame menschlich Geschichte lehrt uns sehr deutlich, dass es Menschenrechte bedarf und jede Organisation, ob religiös oder nicht, welche daran mit beteiligt sind und zwar das Recht von uns Menschen gegen Unrecht zu behaupten ist zumeist gut.
Die Rollenverteilung von Mann und Frau, sind in unseren unterschiedlichsten religiösen Gemeinschaften unterschiedlich definiert, werden unterschiedlich wahrgenommen und unterschiedlich behandelt.
Bisher bewegen sich die meisten großen religiösen Organisationen eher langsamer, mit dem Thema "Mann und Frau" und berufen sich auf g"ttes Wort und entsprechende Interpretationen und Auslegungen.
Man dürfte, als religiöser Mensch, die Entwicklungen der nicht religiös gebundenen Bemühungen, zum Recht von uns Menschen und dem Recht zwischen Mann und Frau, wahrnehmen.
Denn wenn wir uns daran erinnern, was zum Beispiel in Mitteleuropa und im Mittelalter, abgesegnet von den großen Religionen und gebilligt von Königshäusern und dem Adel, an unausgewogenem Verhältnis der Klassengesellschaften und auch zwischen Mann und Frau bestanden und was auf Grund von extern religiösen Einwirkungen, welche auf die großen Glaubensgemeinschaften wirkten und heute noch wirken, sich im Punkt des Menschenrechtes und dem Recht zwischen Mann und Frau, verändert hat, dann dürfen wir, an G“tt glaubenden Menschen, auch dem Verdienst der nicht religiösen Bemühungen und Organisationen unser Anerkennung und Respekt schenken.
Oder möchten wir zurück in alte Verhältnisse?
Schalom
Isaak
Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Gender Mainstreaming
-
29.12.2008, 12:40 #11Isaak Gast
 zurück in alte Verhältnisse
zurück in alte Verhältnisse
Geändert von Isaak (29.12.2008 um 12:46 Uhr)
-
29.12.2008, 12:47 #12
-
29.12.2008, 12:56 #13

Ich schrieb nicht gegen die Menschenrechte und es geht mir in diesem Thread auch nicht um die Menschenrechtskonvention sondern um Gender-Mainstreaming und darum, dass diese Theorie besagt, man könne die Geschlechterrollen beliebig austauschen, gleichgültig welches biologische Geschlecht man ist. Also Männer können Frauen werden usw.
Ein Leben ohne Liebe ist ein Leben gegen das Leben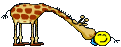
-
29.12.2008, 14:11 #14Isaak Gast
 lernen und verstehen tut mir gut
lernen und verstehen tut mir gut
Lieber Kerzenlicht,
ich glaube schon dein vorgeschlagenes Thema verstanden zu haben und kenne auch ein wenig die Gender-Mainstreaming Theorie.
Der Begriff Gender Mainstreaming „Etablieren der Perspektiven sozialer Geschlechter“, „geschlechtersensible Folgenabschätzung“, „Integration der Gleichstellungsperspektive“, „durchgängige sozialer Gleichstellungsorientierung“ bezeichnet den Versuch, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen sozialen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen.
Der Begriff wurde erstmalig 1984 auf der 3. UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und später auf der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking propagiert. Bekannt wurde Gender Mainstreaming insbesondere dadurch, dass der Amsterdamer Vertrag 1997/1999 das Konzept zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union machte.
Von einer These einer beliebigen Austauschbarkeit der Geschlechterrollen, innerhalb der Gender Mainstreaming Theorie ist mir selbst nichts bekannt.
Vielleicht kannst du ja einen Link oder Nachschlagewerke nennen wo die Gender Mainstreaming Theorie eine beliebige Austauschbarkeit der Geschlechterrollen thematisch behandelt und erklärt.
Shalom
Isaak
-
29.12.2008, 18:11 #15

Anbei aus einem Artikel aus Spiegel-Online
Der Link zum Artikel hier:Wer eine Vorstellung davon bekommen möchte, wie Gender Mainstreaming in der Praxis funktioniert, muss bei Ralf Puchert vorbeischauen. Puchert hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, einen anderen Mann zu formen, er verfolgt den Gedanken, seit er in den achtziger Jahren an der TU Berlin studiert hat. 1989 schloss er sich mit vier anderen Pädagogen aus seiner
Männergruppe zusammen und gründete "Dissens", einen Verein für eine "aktive Patriarchatskritik".
Inzwischen sind die meisten Männergruppen im Orkus der Zeitgeschichte verschwunden, Dissens aber ist ein florierender Betrieb mit 20 Mitarbeitern, eine Art Allzweck-Anbieter für progressive Geschlechterarbeit. Die späte Blüte verdankt der Verein auch dem Umstand, dass Gender-Mainstreaming-Projekte seit einigen Jahren großzügig gefördert werden; Aufträge kamen schon von der Stadt Berlin, der Bundesregierung, der EU-Kommission.
Spezialgebiet des Vereins ist Jungenarbeit. Von dieser hat Dissens eine sehr eigene Vorstellung, denn es geht dabei auch darum, Jungs früh zu Kritikern des eigenen Geschlechts zu erziehen. Es gibt ein einprägsames Beispiel, wie die Gender-Theorie Eingang gefunden hat in die angewandte Pädagogik.
So spielten Dissens-Mitarbeiter bei einer Projektwoche mit Jungs in Marzahn einen "Vorurteilswettbewerb", an dessen Ende die Erkenntnis stehen sollte, dass sich Männer und Frauen viel weniger unterscheiden als gedacht. Es entspann sich eine heftige Debatte, ob Mädchen im Stehen pinkeln und Jungs Gefühle zeigen können, Sätze flogen hin und her. Am Ende warfen die beiden Dissens-Leute einem besonders selbstbewussten Jungen vor, "dass er eine Scheide habe und nur so tue, als sei er ein Junge", so steht es im Protokoll.
Einem Teenager die Existenz des Geschlechtsteils abzusprechen ist ein ziemlich verwirrender Anwurf, aber das nahmen die Dissens-Leute in Kauf, ihnen ging es um die "Zerstörung von Identitäten", wie sie schreiben. Das Ziel einer "nichtidentitären Jungenarbeit" sei "nicht der andere Junge, sondern gar kein Junge".
Die UNO beschließt, was man daraus macht, ist was anderes. Und nicht alles, was die UNO beschließt, muss gut sein.Geändert von Kerzenlicht (29.12.2008 um 18:16 Uhr)
Ein Leben ohne Liebe ist ein Leben gegen das Leben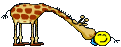
-
30.12.2008, 20:18 #16

Es gibt selbstverständlich anatomische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die so augenscheinlich sind, dass sie seit Adam und Eva nicht wirklich von irgendjemandem bestritten werden können. Aber sind Männer und Frau auch tatsächlich in ihrem Denken, Handeln und Fühlen gleich? Gibt es Unterschiede in der biologischen Struktur?
Die Frage entwickelt immer dann eine besondere Brisanz, wenn sie vor dem Hintergrund unserer tradierten Wertstellungen zwischen Männern und Frauen beantwortet werden soll.
Die Höherwertigkeit des Mannes respektive Minderwertigkeit der Frau hatte sich in unserer stark patriarchalisch geprägten Gesellschaft so stark verinnerlicht, dass sämtliche Bestrebungen zu einer Gleichstellung der Geschlechter zwangsläufig das Ziel vor Augen hatten, biologische Unterschiede nachweislich auszuschließen.
Mittlerweile sollten wir alle etwas klüger sein. Es gibt natürlich sozial- und erziehungsbedingte Unterschiede, die man durch äußere Einflüsse vermeiden könnte wenn man wollte. Daneben gibt es allerdings durchaus biologisch begründete Unterscheidungsmerkmale zwischen den Geschlechtern, die als höher- oder minderwertig, besser oder schlechter zu bewerten man gar nicht erst auf die Idee kommt, wenn man die Gleichwertigkeit der beiden Geschlechter von vornherein als selbstverständliche Gegebenheit voraussetzt.
Ich bin froh um die Unterschiede und möchte es gar nicht anders haben - gerade weil sie im partnerschaftlichen Miteinander eine oft sehr schöne Ergänzung zueinander darstellen können.
 Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.(Art. 4 Abs. 1 GG)
Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.(Art. 4 Abs. 1 GG)
-
31.12.2008, 11:26 #17Athame Gast
-
07.01.2009, 11:25 #18

Es gibt ein sehr gutes Buch zum Thema:
Bischof-Köhler, Doris: Von Natur aus anders. Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede
Bei Amazon: http://www.amazon.de/Von-Natur-aus-a...1323526&sr=8-1 (Ausgabe von 2005 ist gebraucht billiger)
Da wird die These vertreten, dass die Unterschiede nicht nur anerzogen sind, sondern Jugen und Mädchen eben "von Natur aus anders" sind. Die Autorin ist glaub ich Biologin (ist schon eine Weile her ...) aber man muss keine Vorkenntnisse haben, um das Buch gut zu verstehen. Sie untermauert alles mit Studien etc. Mich hat es sehr überzeugt, ist auch angenehm zu lesen und superinteressant geschrieben.
Die nur mittelmäßige Durchschnittsbewertung bei Amazon ist, vermute ich mal, auf die großen Meinungsunterschiede zurückzuführen. Natürlich fühlen sich da Geisteswissenschaftler "ans Bein gepieselt".
Liebe Grüße,
+Eliza+Die Tugend eines Menschens sollte nicht an seinen besonderen Leistungen gemessen werden, sondern an seinem alltäglichen Handeln ------ Blaise Pascal
-
09.01.2009, 14:01 #19

- Registriert seit
- 09.01.2009
- Ort
- München
- Beiträge
- 5

Hallo Jim-Knopf (netter Name!)
in der Presse hat man zu den Worten unseres Papstes auch Kritik von Homosexuellen und Transsexuellen gelesen. Gerade bei letzteren sind ja nun die anatomischen Merkmale nicht ausschlaggebend für die geschlechtliche Empfindung. Es gibt auch Kinder, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen.
Wie kann ich das mit den Worten des Papstes verbinden?
-
09.01.2009, 20:04 #20

Hallo Patricia,
die von dir erwähnten Besonderheiten sind selbstverständlich auch eine der vielen, vielen Launen der Natur, die so nicht bedacht habe. Da hast Du vollkommen recht. Aber im Prinzip bleibt es ja doch bei der grundsätzlichen These, dass man jeden Menschen - die Unterschiede zwar erkennend - mit seiner eigenen Persönlichkeit respektieren und wertschätzen soll. Die Selbstverständlichkeit einer Gleichberechtigung "aller" Geschlechter bleibt hier natürlich unberührt.
Und was die Stellungnahmen des Papstes zu so manchen Themen angeht, da kann einem schon mal das Messer in der Tasche aufspringen. Aber das könnte man wahrscheinlich abendfüllend ausbreiten.Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.(Art. 4 Abs. 1 GG)





 Zitieren
Zitieren





Lesezeichen